Anerkennung als Forschungseinrichtung
Das Freie Institut für nachhaltige Städtebauentwicklung und Konservierungskonzepte in der Denkmalpflege wurde Ende November 2025 offiziell als Forschungseinrichtung beim Projektträger Jülich anerkannt.
PtJ ist eine der größten deutschen Einrichtungen für Forschungs- und Projektmanagement und arbeitet im Auftrag von Ministerien und der Europäischen Kommission, um Forschungsvorhaben zu fördern und zu begleiten.
Diese Anerkennung eröffnet uns neue Perspektiven in der Wissenschafts- und Forschungslandschaft und ebnet den spannenden Weg für kommende Projekte.
Einsatz von Gaussian Splatting in der Denkmalpflege
Die digitale Erfassung historischer Bauwerke und Kulturgüter ist in unseren Büros bereits ein zentrales Werkzeug moderner Denkmalpflege. Neben etablierten Methoden wie Laserscanning und Photogrammetrie gewinnt eine neue Technologie zunehmend an Bedeutung: Gaussian Splatting. Diese aus der Computergrafik und KI-gestützten 3D-Rekonstruktion stammende Methode ermöglicht sehr detailreiche und zugleich effiziente digitale Modelle realer Objekte. Welches Potenzial bietet sie konkret für die Denkmalpflege und was ist Gaussian Splatting?
Gaussian Splatting stellt Objekte nicht primär als Punktwolken oder Polygonnetze dar, sondern als Ansammlung vieler 3D-Gaußsche Verteilungen („Splats“). Jede dieser Verteilungen beschreibt ein kleines Volumen mit Attributen wie Farbe, Größe, Form und Transparenz. Durch Überlappung der Splats entstehen kontinuierliche, fein differenzierte Oberflächen und realistische Lichtinteraktionen. Zusätzlich kann das System adaptiv arbeiten: Splats werden in Bereichen mit hoher Detaildichte oder bei Perspektivwechseln dynamisch verfeinert (Splitting/Refinement), wodurch eine effiziente, selbstoptimierende Repräsentation entsteht.
Wesentliche Vorteile im Einsatz für die Denkmalpflege
- Hohe Detailtreue: Feinstrukturen wie Verzierungen, Risse, Abplatzungen, Patina oder Reliefs lassen sich sehr gut abbilden.
- Schnelligkeit: Bei geeignetem Workflow kann die Erfassung und Modellierung deutlich schneller erfolgen als klassischen Photogrammetrieprozessen.
- Kosteneffizienz: In vielen Fällen genügt eine handelsübliche Kamera (DSLR oder Smartphone) in Kombination mit moderner GPU-Leistung; alternativ kann die Methode auch lidar-gestützte Daten integrieren. Weiterhin ist ein Vorteil, dass in den Berechnungsvorgängen je nach eingesetzter Software zusätzlich Daten aus der Photogrammetrie oder dem terrestrischen Laserscanning einbezogen werden.
- Kontaktlose Erfassung: Wie Photogrammetrie ist Gaussian Splatting berührungslos — physische Marker oder direkter Scannerkontakt sind nicht zwingend erforderlich.
- Mobilität und Zugänglichkeit: Leichte Setups erlauben den Einsatz direkt vor Ort, auch in schwer zugänglichen Bereichen von Bauwerken.
- Geringe Datenvolumina: Die entstehenden Modelle können kompakter sein als hochauflösende Polygonnetze oder dichte Punktwolken.
- Einschränkung: Trotz oft kleinerer Dateigrößen ist die Verarbeitung rechenintensiv und profitiert stark von leistungsfähigen GPUs; aktuell besteht hier noch ein hoher Rechenaufwand in der Nachbearbeitung.
Anwendungsfelder und Perspektiven
Gaussian Splatting steht zwar noch am Anfang seiner praktischen Anwendung in der Denkmalpflege, das Potenzial ist jedoch groß. Mögliche Einsatzfelder sind:
- Konservierung und Zustandsdokumentation: hochauflösende 3D-Aufnahmen zur Analyse von Schäden und Materialalterung.
- Forschung: detaillierte Modelle für Analysen, Messungen und Vergleiche.
- Vermittlung: realistische Visualisierungen in Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) für Bildung und Öffentlichkeit.
- Integration in BIM-Workflows: Mit Fortschritten bei semantischer Anreicherung könnten Splats zukünftig automatisiert in strukturierte BIM-Objekte (z. B. IFC) überführt werden — inklusive Metadaten zu Material, Zustand oder Datenerhebungsparametern. Dadurch würden HBIM-Modelle visuell realistischer und gleichzeitig mit geringem Modellierungsaufwand besser für Planungs- und Dokumentationszwecke nutzbar.
Mit fortschreitender Hardwareentwicklung und besser integrierter Software wird Gaussian Splatting voraussichtlich an Bedeutung gewinnen und sich als Standardwerkzeug für die digitale Erfassung historischer Objekte und Bauwerke etablieren. Insbesondere die Kombination aus visueller Qualität, Erfassungsflexibilität und Effizienz macht die Methode für Konservierung, Forschung und Vermittlung in der Denkmalpflege besonders vielversprechend.
Solar-Module auf denkmalgeschützten Dächern: Änderungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 2023
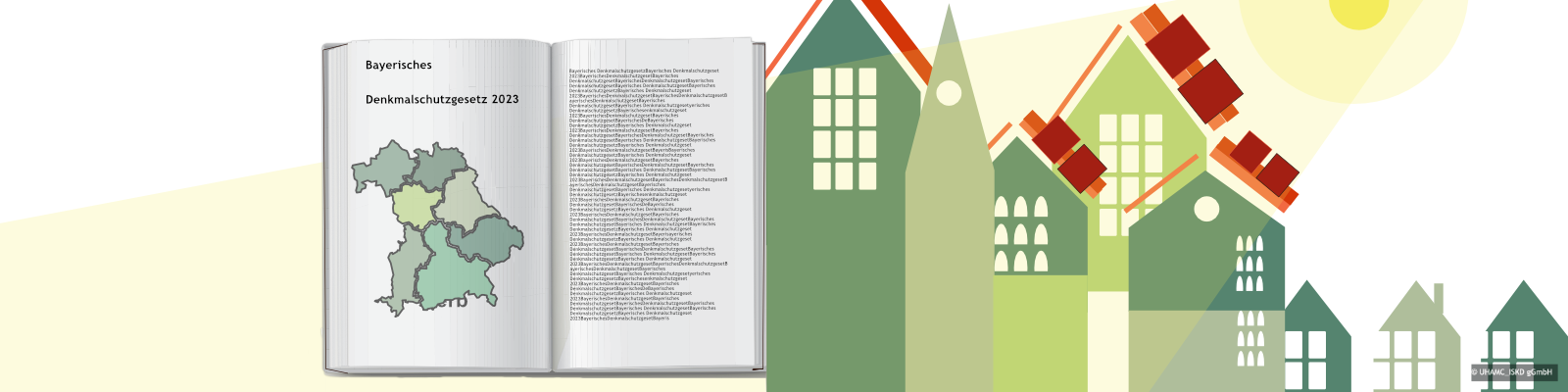
Der Bayerische Landtag hat die Änderungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes am 14. Juni 2023 verabschiedet.
Das Gesetz bringt in etwa 20 Artikeln wichtige Veränderungen für die Denkmalpflege mit sich, darunter auch die Möglichkeit einer erleichterten Integration erneuerbarer Energien im denkmalgeschützten Umfeld – im Einklang mit fachlichen Standards und Verantwortungsbewusstsein.
[In der Blog-Übersicht wird hier ein Weiterlesen-Link angezeigt]
Laut der Webseite des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, will das Gesetz „Denkmäler schützen, Energiepotenziale nützen und Kommunen unterstützen“.
Die neuen Gesetzesänderungen wurden am 01. Juli 2023 wirksam.1
Der vollständige Text des Gesetzes und seine Änderungen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/2023-251/
Die wesentlichen Regelungen für erneuerbare Energieanlagen in Baudenkmalen werden wie folgt definiert:
1. Vorfahrt für den Energie(eigen)bedarf: Eine denkmalrechtliche Erlaubnis darf nur abgelehnt werden, wenn überwiegende Grundsätze des Denkmalschutzes dagegen sprechen. Vorrangig sollen die Anlagen den Energiebedarf des Baudenkmals decken oder zu dessen energetischer Verbesserung beitragen. Überschüssige Energieeinspeisung wird begrenzt, um das historische Erscheinungsbild zu bewahren.
2. Installation der Anlagen und Erhalt des Baudenkmals: Die Substanz des Baudenkmals soll weitestgehend bewahrt bleiben, es muss eine denkmalpflegerisch verträgliche Einbindung der Anlagen ins Erscheinungsbild erfolgen.
3. Fachliche Planung der Anlagen: Erforderliche Maßnahmen für einen effizienten Gebäudebetrieb müssen individuell festgelegt werden. Qualifizierte Fachplaner wie z.B. Energieberater im Baudenkmal müssen angemessene, prüffähige Unterlagen vorlegen.
4. Eignungsprüfung der Anlagen anhand eines Stufenmodells: In der Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) kann die regelmäßige Denkmalverträglichkeit von Anlagen anhand eines Stufenmodells für verschiedene denkmalgeschützte Bauten entwickelt werden. Die Verwendung von individuellen Lösungen wird bevorzugt, um Standardlösungen zu vermeiden. Unter mehreren Optionen wird diejenige ausgewählt, die am besten mit den Denkmalschutzanforderungen vereinbar ist.
5. Sichtbarkeit der Flächen: Auf nicht einsehbaren Flächen ist der Einbau herkömmlicher Anlagen in der Regel, unter der Prämisse des Erhalts denkmalgeschützter Substanz und in Abstimmung mit den Fachbehörden, erlaubt.
6. Sichtbarkeit der Flächen im Fall der Einzeldenkmale, Ensembles und Nähefällen: In sichtbaren Bereichen von Ensembles und Einzeldenkmalen können denkmalverträgliche PV-Anlagen (z. B. Solarziegel, Solarfolien, in die Dachfläche integrierte Anlagen etc.) und Geothermie-Anlagen genehmigt werden, sofern Substanz und Erscheinungsbild geschützt bleiben. Entsprechendes gilt bei sog. Nähefällen.
7. Fördermöglichkeiten: Die Mehrkosten für denkmalverträgliche Anpassungen von Anlagen erneuerbarer Energien sowie energetische Sanierungen der Denkmäler sind förderfähig.
Diese Regelungen orientieren sich an Art. 6 Absatz 2 Satz 3 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) in seiner neuen Fassung (gilt ab 01. Juli 2023)2.
1. Änderungen im Denkmalschutz (FAQs) (bayern.de);
2. Vgl. Änderungen im Denkmalschutz (FAQs) (bayern.de):
https://www.stmwk.bayern.de/kunst-und-kultur/denkmalschutz/aenderungen-im-denkmalschutz-faqs.html

